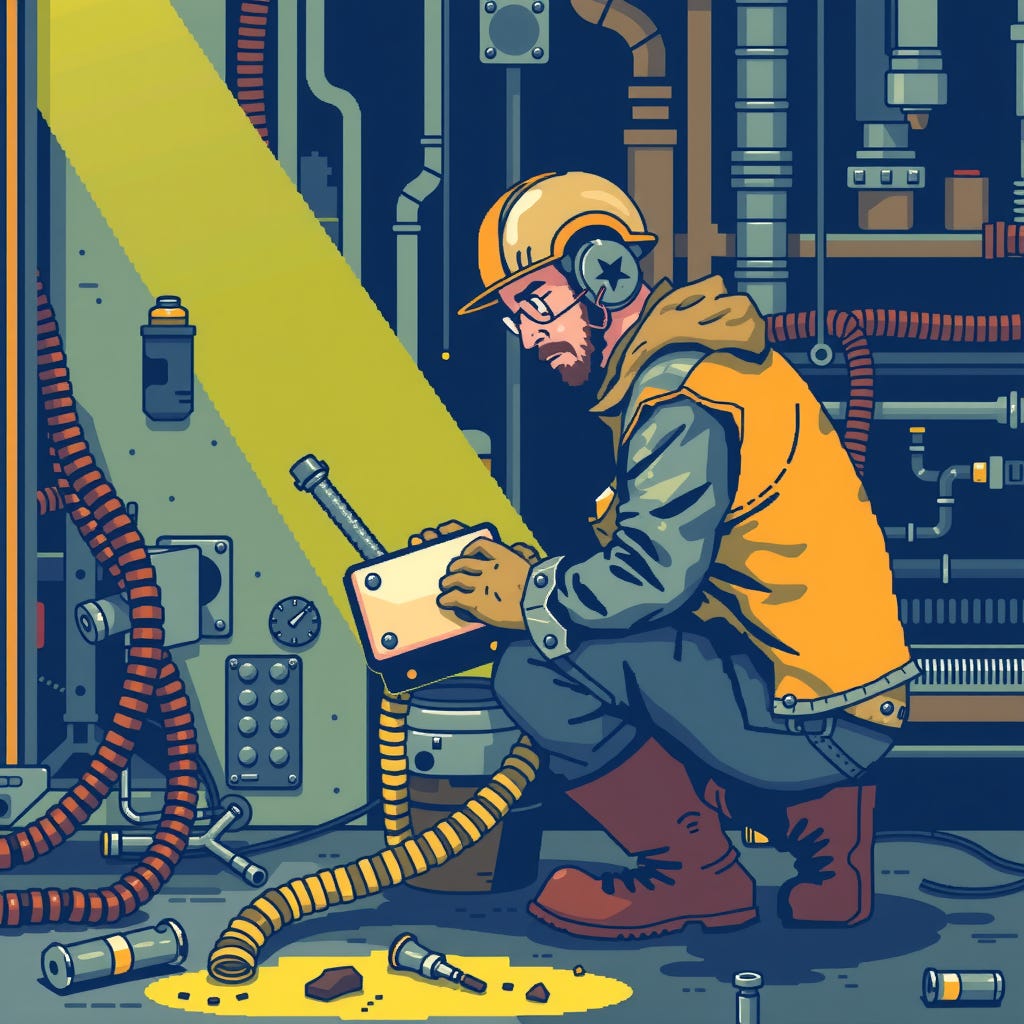Datenpolitik #28: Langweilige Infrastruktur
Digitale Infrastruktur bietet Material für spannende Agenten- und Heldenstorys. Aber niemand in Österreich redet darüber - so wenig, dass jetzt ein EU Vertragsverletzungsverfahren startet.
Regierungsverhandlungen laufen in ziemlich vielen ziemlich kleinteiligen Teams, für deren Besetzung alle beteiligten Parteien tief in die Mottenkiste gegriffen haben. Da verhandeln Agrarlobbyisten über Umweltthemen, Aufsichtsräte eines Unternehmens über das Unternehmen, dessen Rahmenbedingungen neu gestaltet werden sollen (nämlich ORF-Stiftungsräte über den ORF), Ex-Mandatare, die zwischendurch bei anderen Parteien ihr Glück versucht haben, werden reaktiviert, religiöse Extremisten verhandeln Fragen der sexuellen Selbstbestimmung - mit einem Wort: Politik. Oder mit drei Worten: Politik in Österreich.
Stiefkind Digitalpolitik
Bei vielen Themen liegen Diskussionspunkte auf der Hand. Man kann sich vorstellen, dass in Wirtschaftsgruppen über Inflation, und Rezession gesprochen wird, über Wohnkosten oder den Arbeitsmarkt. In Medienfragen wird es um den ORF und Korruption gehen. In Gleichbehandlungsgruppen um Pay Gaps, Schwangerschaftsabbruch und Pensionsmonate.
Aber worüber redet die Digitalpolitik? Es liegt nicht an der vornehmen Diskretion der dort engagierten Verhandler, dass man so gar keine Vorstellung davon hat, was dort Thema sein könnte. Es liegt eher am nahezu gänzlichen Fehlen jeglicher digitalpolitischen Themensetzung in normalen Zeiten, dass dem interessierten Beobachter hier wenig einfällt. Vielleicht ein wenig Überwachung. Vielleicht, weil Digitalisierung ja unheilvoll in die Nähe von Bildung gerückt wird, geht es um Schulen und Tablets. Die Digitalkompetenzen von SchülerInnen sind im übrigen schlechter geworden, seit im großen Stil Tablets im Unterricht eingeführt wurden. Vielleicht weiß auch jemand, dass IT-Security wichtig ist. Aber was sind zentrale Themen der heimischen Digitalpolitik?
Ich habe eine zeitlang versucht, die Aktivitäten der Digital- oder NetzsprecherInnen der Parlamentsparteien zu verfolgen. Das war nicht leicht, denn auf ihren Social Media-Kanälen und in ihren Aussendungen beschäftigten sie sich mit Weinfesten, Gartenarbeit oder Feuerwehrfesteröffnungen, aber recht wenig mit jenen Themen, über die sie für uns entscheiden sollen.
Kommt eh der Satellit
Dabei gäbe es durchaus spektakuläre Fragestellungen, die ausreichend Stoff für große Heldenreisen bieten. Die Rechnung dafür, dass diese Geschichten nicht erzählt werden, bekommt Österreich im übrigen dieser Tage präsentiert. Die Europäische Union startet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich wegen mangelnder Ambition zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie, die zum Schutz kritischer Infrastruktur verpflichtet. Dazu zählen auch digitale Netze. Österreich hat zu wenig getan, um die Hardware des Internet zu schützen - und politische AkteurInnen haben sich praktisch überhaupt nicht dafür interessiert. Die Richtlinie ist generell in Europa noch nicht gut umgesetzt.


Ist ja auch oldschool, Funkmasten oder Leitungskabel schützen zu wollen, könnte man meinen. Kommt eh der Satellit. Genau das ist der Haupteingang zum eigentlichen Problem, nur sind diese Grundlagen kaum jemals Thema.
Was ist das Problem? Plattformen sind unreguliert. Große Dienstleister bearbeiten eine Fülle von Geschäftsfeldern und sind auf B2C-Ebene Quasimonopolisten mit Social Networks. Auf der B2B-Ebene nutzen Unternehmen Cloud-Services ebendieser Dienstleister und gehen intensive Abhängigkeitsverhältnisse ein. Inhalte und große Teile der Infrastruktur sind über große Strecken zugleich unreguliert und monopolisiert. Politik und Gesellschaft schaffen hier nicht mehr die Regeln, diese liegen in der Hand einiger weniger Unternehmen.
Einer der letzten Teilbereiche, die noch in der Hand von Staat und Politik liegen, sind Netze und Funkfrequenzen. Jeder kann Cloud-Services in Österreich anbieten. Aber nicht jeder kann die Netze zur Verfügung stellen, über die diese Services auch genutzt werden können. Hier regeln Lizenzen und Bieterverfahren den Markt, hier behalten Staaten die Hand auf den Zugängen. Wegen dieser Zugriffsmöglichkeiten funktionieren Netzsperren und Inhaltsbeschränkungen oder regionale Sonderlösungen bis hin zur Social Media-Steuer in Uganda, die nach einige Jahren dann doch durch einen allgemeinen Preisaufschlag für Internetzugangsdienste ersetzt wurde. Wegen dieser Möglichkeiten lassen sich aber auch Prinzipien wie Netzneutralität und freier Zugang durchsetzen.
Das größte, eigentlich das einzige relevante Satellitennetzwerk, ist Musks Starlink. Bislang ist Satelliteninternet eine teure Notfallsalternative. In den Startlöchern scharrende Konkurrenz der anderen großen Cloud-Platzhirschen wird das ändern - und damit verlieren Staat und Gesellschaft ihre aktuell letzte Durchgriffsmöglichkeit auf das Netz, im Guten wie im Schlechten.
Während der Corona-Pandemie stiegen vergessene Themen wie fragile Lieferketten oder die nationale Selbstversorgung mit Lebensmitteln und Energie mit Lichtgeschwindigkeit in Prioritätenpyramiden nach oben. Nach den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs waren es Militärbudgets und sogar nationale Rüstungsindustrien. Digitale Infrastruktur war in Westen noch kaum Thema. Und in der Ukraine war es Musks Starlink, das der Ukraine Vorteile verschaffen sollte, zum Spielball für vage Drohungen wurde und Musk schließlich sogar einen Platz an Donald Trumps Telefon zum Gespräch mit Wolodymyr Selenskyj verschaffte.
Kein Twitter oder gleich kein Internet?
Langweilige digitale Infrastruktur ist die Grundlage für fancy Innovation. Letzte Woche habe ich für einen nüchternen Blick auf Digitalisierung plädiert, der vor allem Professionalisierung als relevante Ausprägung von Digitalisierung in den Vordergrund stellt.
Digitalisierung braucht klare Abläufe. Das betrifft die internen Prozesse, deren Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit und auch das Wissen darum, auf welcher Grundlage Digitalisierung läuft. Zu Digitalisierung im großen Stil gehört Business Continuity Management - und das wird zum Glücksspiel, wenn es keine Ansprechpartner für Kriseninfrastruktur mehr gibt, sondern buchstäblich ein Mann im Mond hinter dem Satelliten die letzte Anlaufstelle wäre. Über diese grundlegende Infrastruktur können Unternehmen nicht entscheiden, das ist ein politisches Betätigungsfeld. Eines, zu dem ich keine relevanten politischen Wortmeldungen kenne, die über Breitbandinitiativen hinausgehen.
Ich habe zur Sicherheit noch mal gegoogelt, weil man PolitikerInnen ja schnell mal etwas unterstellt. Überraschende Ausnahme war ein Abschnitt zum Digitalen Humanismus bei der SPÖ, der die Infrastrukturdiskussion klassenkämpferisch verbrämt. Gefunden habe ich überdies diese Podcast-Folge, in der Nikolaus Forgó, Georg Serentschy und Michael Seitlinger ähnliches beklagen und feststellen, dass Digitalpolitik anstelle einer Strategie eher der Logik von Tauschgeschäften folge und dazu diene, hier oder dort ein Ressort aufzufetten oder jungen PolitikerInnen Karrierechancen an die Hand zu geben.
Dabei hat, ich wiederhole mich, Digitalisierung schon einige Jahrzehnte hinter sich, Florian Tursky ist auch nur dann jung, wenn man sich vor Augen hält, dass dem Mann bereits ein Hofratstitel verliehen wurde, und Claudia Plakolm ist mit dem Digitalen noch nicht ganz so auf du und du wie mit dem Blasmusikkapellmeister.
Was sich davon in Regierungsprogrammen wiederfinden wird?
Was davon kann sich sinnvollerweise in nationalen Regierungsprogrammen wiederfinden? Vieles ist aus guten Grund EU-Kompetenz, national wünscht man sich trotzdem informierte Politik, die Richtlinien sinnerfassend umsetzen kann.
Immerhin gibt es in Österreich eine neue Beschwerdestelle. Die RTR ist jetzt offizielle Schlichtungsstelle für Streitigkeiten nach dem DSA, um zwischen Plattformen und deren NutzerInnen in eventuellen Streitigkeiten um Accountsperren oder Contentlöschungen zu vermitteln. Klingt nach Bürokratie - ist aber ein wichtiger Berührungspunkt, der deutlich macht, wie weit die Macht der Plattformen reicht und in wie vielen Bereichen sie das Leben der Menschen beeinflussen.
Und auch eine solche kleine harmlos wirkende Schlichtungsstelle hat es, nimmt man Elon Musks Sprüche in seiner neuen Rolle als Regierungsberater für größtmögliches Chaos ernst, in der Hand, ob die NATO weiterhin auf die USA zählen kann oder nicht.
Werden wir darüber reden? Aktuell ist übrigens European Cybersecurity Month.
Ratspräsidenten gegen Chatkontrolle
Polen ist übrigens nächster Vorsitzender im EU Rat. Zuletzt - Stand Oktober - hat sich Polen gegen die Durchsetzung der Chatkontrolle ausgesprochen. Ungarn, aktuell Ratspräsident, ist mit Anläufen zur Durchsetzung der Chatkontrolle nicht durchgekommen. Die Sperrminorität (Staaten, die 35% der EU-Bevölkerung vertreten) ist allerdings nur noch dünn. Die Debatte ist noch nicht vom Tisch.