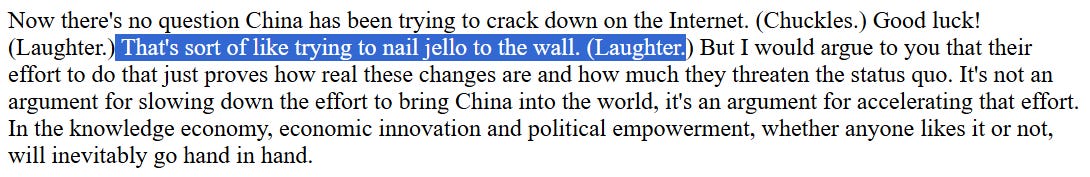Datenpolitik #38: Datengeopolitik
Wie viele Internetvarianten gibt es zwischen China, Europa, USA, Russland, freiem, kommerziellem, sicherem oder sauberem Netz?
Das Internet regulieren? Na viel Spaß und viel Glück! - Es war der damalige US-Präsident Bill Clinton, der sich hier einen billigen Lacher sicherte. Adressat seines Scherzes war China. Die Volksrepublik habe doch tatsächlich versucht, das Internet unter Kontrolle zu bringen. Das sei ja wie der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Das Publikum war unterhalten, seither sind 30 Jahre vergangen - und die Idee, das Netz zu regulieren, trägt für manche immer noch Grundzüge absurden Humors. Das ist absurd.
Der Pudding hängt an der Wand
Die Netze der USA, Chinas und der EU sind mittlerweile grundlegend unterschiedliche Netze - und sie sind das aufgrund unterschiedlicher Regeln. China war mit seinem Vorhaben, den Pudding an die Wand zu nageln, überaus erfolgreich.
In einem schon 2018 erschienenen und seither öfters zitierten Paper zur Geopolitik der Internetideale unterschieden die Autoren des Centre for International Governance Innovation gar zwischen vier verschiedenen Internetarten. Im Silicon Valley promote man die Idee des ursprünglichen offenen Internet, in Europa sei man darauf aus, ein bourgeoises Internet zu etablieren, in dem User gesittet miteinander interagieren, China habe ein autoritäres Internet zu Kontrollzwecken geschaffen. Russland schließlich missbrauche das Netz vor allem als Hacking- und Desinformationstool. In den Startlöchern orteten die Autoren ein fünftes Internet: In Washington favorisiere man gegenüber dem offenen Internet des Silicon Valley ein kommerzielles Internet.
2018 war Trump ebenfalls Präsident. 4 Milliarden Menschen, die Hälfte der Weltbevölkerung, war online, 3 Milliarden von ihnen, Trend steigend, nutzten Social Media. Die meistbesuchten Webseiten der Welt waren Google, Youtube und Facebook vor Baidu. Auch damals war ein offenes Internet also eher nur noch in Spurenelementen vorhanden. Abseits der großen Plattformen bleibt nur noch ein verschwindend geringer Trafficanteil für die über 99 Prozent des restlichen Web.
Das bourgeoise Internet war vielleicht einmal eine europäische Phantasie jener, die sich auch Klarnamenpflicht und ähnliche Kontrollinfrastrukturen wünschen. Leider sind Tonfall und Trolle noch immer die ersten Gedanken mancher, wenn Plattformregulierung zur Sprache kommt. Tatsächlich steht aber mehr auf dem Spiel: Ein offenes Internet wäre heute eher in Europa anzusiedeln als in den USA.
Wenn einander nun ein kommerzielles, ein offenes und ein autoritäres Netz gegenüberstehen, welche Anforderungen stellt das an Digitalpolitik? Kann es noch angemessen sein, über Regulierungsversuche zu lachen? Praxis und Erfahrung zeigen, dass Regulierungen und Sperren schon lange überaus erfolgreich sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass autoritäre Regulierungen besser greifen als liberale. Das bedeutet aber auch, dass liberale Digitalpolitik das Repertoire der autoritären Digitalpolilitk verstehen muss. Neben atmosphärischen Elementen, die sich in medienpolitischen Fragen oder Internetsperren niederschlagen, sind das vorrangig Infrastukturthemen, die die Grundlage dafür schaffen, Regeln überhaupt durchsetzen zu können. Dabei hat Europa grundsätzlich schlechte Karten, für einzelne - kleine Staaten - gilt das noch viel mehr.
Außenpolitik mit Daten
Ein zweiter häufig unterschätzter Punkt ist Datengovernance als Geopolitik. Chinesische Policies wurden dabei zuletzt häufiger betrachtet, wirken sie sich doch auch direkt auf die interne Kommunikation chinesischer Niederlassungen ausländischer Unternehmen mit ihren Zentralen aus.
Europa hat ebenfalls strenge Datengovernance-Regeln. Den jeweiligen Frameworks liegen sehr unterschiedliche Prinzipien zugrunde. China stellt nationale Sicherheit und Zugriffsmöglichkeiten für Behörden in den Vordergrund, in Europa sind Datenschutz und Consent leitende Prinzipien. Beide Frameworks enthalten zentrale Bestimmungen darüber, welche Art von Daten unter welchen Bedingungen und zu welchem Zweck außerhalb des eigenen Einflussbereichs gespeichert werden dürfen. In der chinesischen Perspektive steht im Vordergrund, Daten im eigenen staatlichen Einflussbereich zu behalten. Für Europa hat Priorität, Daten (vor allem persönliche Daten europäischer Bürger) nicht fremdem Einfluss auszuliefern. Und China hat - als Zentralstaat - zentrale Macht, die eigenen Regeln durchzusetzen. Europa ist auf Nationalstaaten und deren Behörden angewiesen.
Die Durchsetzungskraft der verschiedenen Mächte und Frameworks steht vor allem dort auf dem Prüfstein, wo verschiedene Regularien über unterschiedlichen Ordnungen unterliegenden Unternehmen auf neutralem Boden aufeinandertreffen. Die Naumann-Stiftung hat dazu eine Analyse der digitalpolitischen Situation Marokkos im Spannungsfeld zwischen USA, Europa und China veröffentlicht. Marokko hat traditionell und kulturell Verbindungen zu Europa, insbesondere zu Frankreich und Spanien. Technisch spielen in der marokkanischen Digitalwirtschaft natürlich die USA eine große Rolle. Wichtiger Geldgeber für Digitale Infrastruktur ist China. Aus europäischer Sicht unsichere chinesische Hardware und ungünstige Verträge, europäische Datenschutzprinzipien und Bedenken gegenüber Datenhaltung unter chinesischem Einfluss, Machtspiele zwischen chinesischen und US-Geldgebern - daran reibt sich die marokkanische Digitalwirtschaft gerade auf. Wir reden hier noch gar nicht von Startups oder dem Next Big Digitalthing aus Marokko, sondern von einfachsten Digitalisierungsmöglichkeiten und leistungsfähiger Netzverbindung für Wirtschaft und Bevölkerung. Die erpresserische Schattenseite chinesischer Brick-&Mortar-Infrastrukturkredite in Afrika st bekannt. Die fester werdende Griff russischer und chinesischer Pressuregroups auf afrikanische Medien ebenso. Digitale Infrastruktur als lohnende Einflusssphäre ist neu - aber effizient.
Sonst noch neu
Man kann auch Acemoglu und Robinson zur Analyse von Digitalwirtschaft heranziehen:
Die Theorie der inklusive Institutionen kann auch ein Wegweiser zu neuen Regeln für die Digitalwirtschaft sein. Denn Digitalmärkte haben sich zu geschlossenen Gesellschaften entwickelt.
Verhandlungen zur UN Digitalpolitik lassen das Playbook von Anne Applebaums Achse der Autokraten erkennen.
Noch effizienter als wirtschaftliche Autokraten-Netzwerke sind deren bedenkliche Neuinterpretationen von Menschenrechten, Multilateralismus, Respekt und Nichteinmischung.