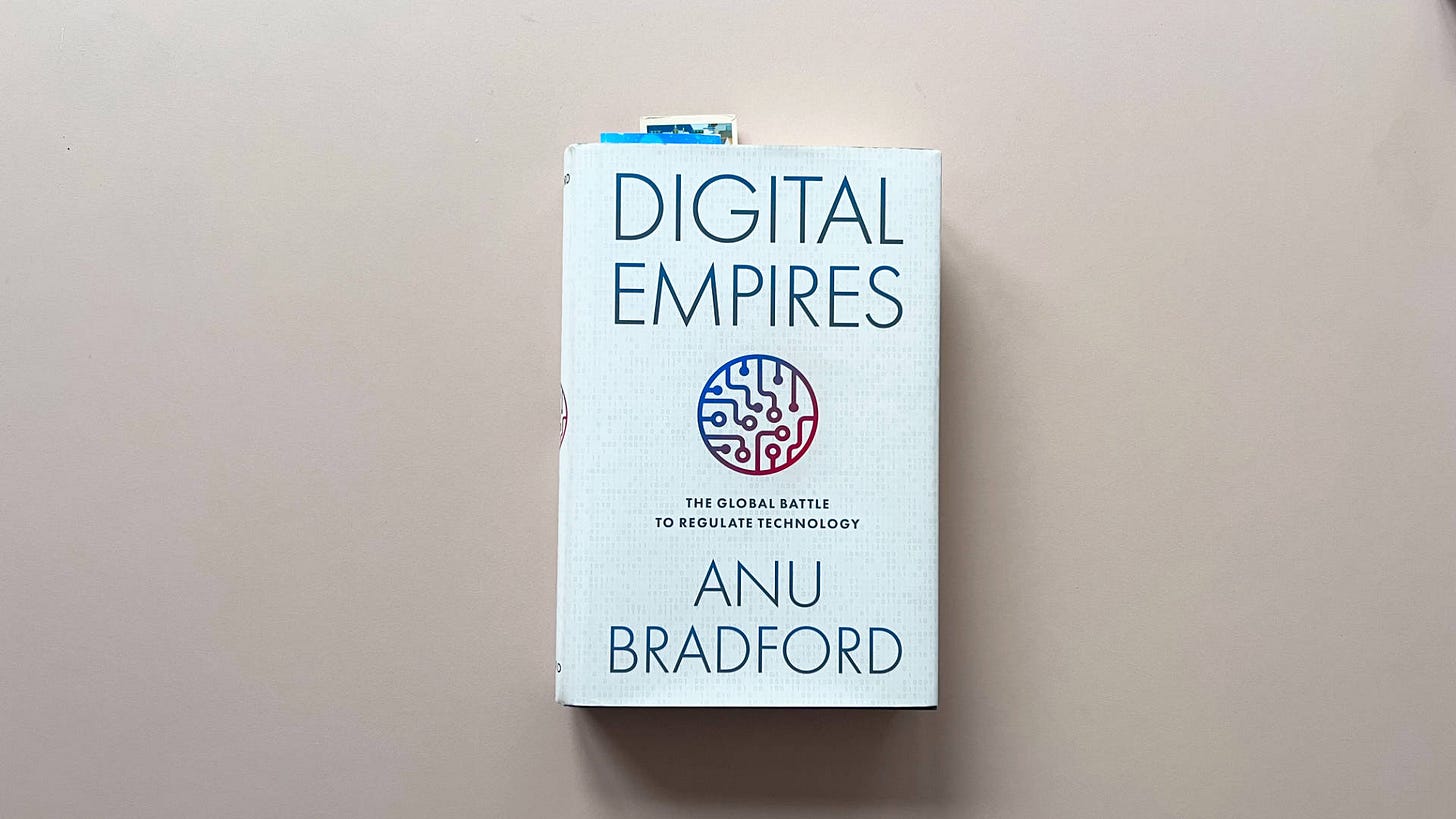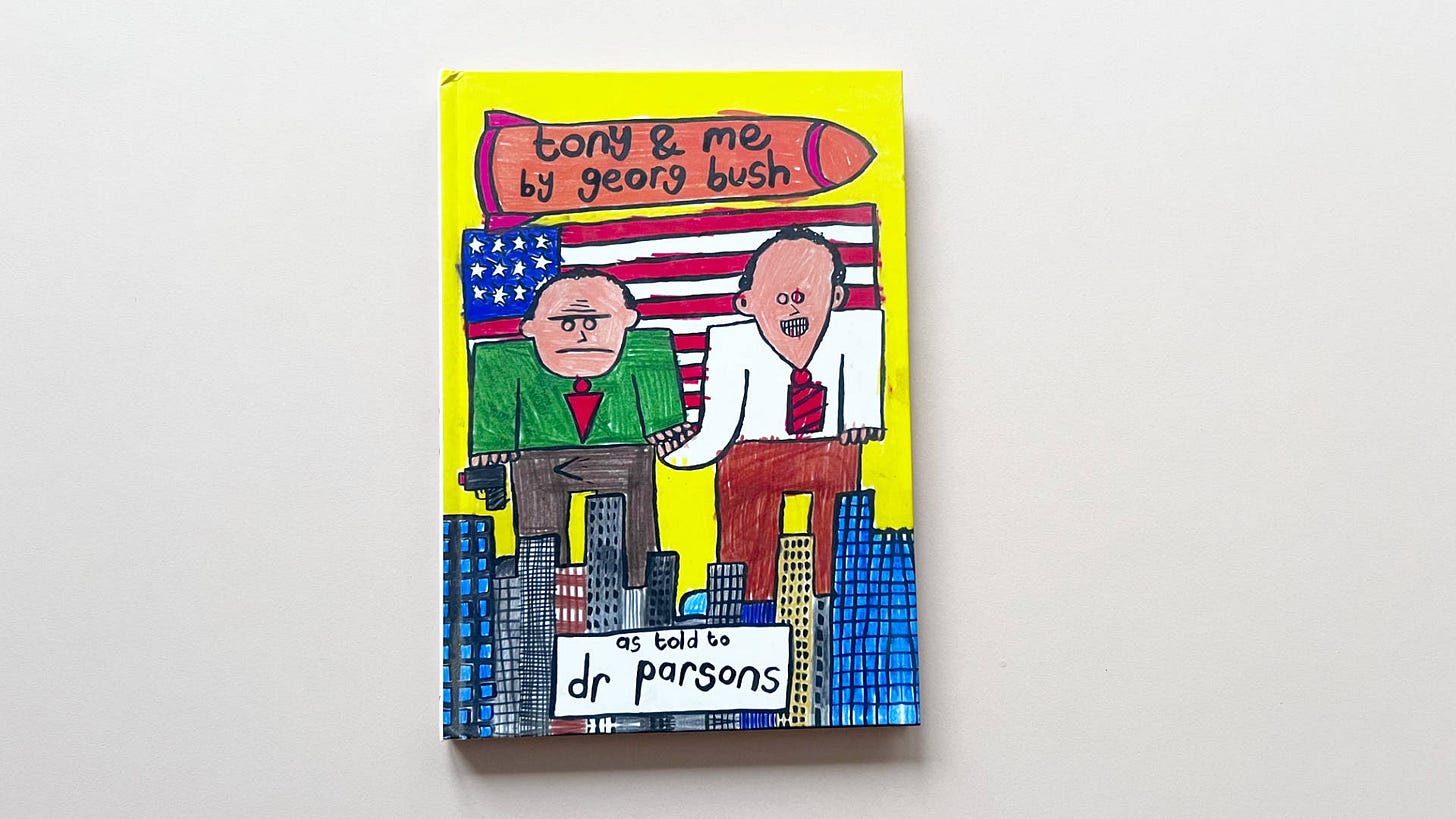Datenpolitik #40: Souveränitätsrenaissance
Alle wollen digitale Souveränität. Eine optimistische Diagnose sah die EU im Rennen dabei tonangebend. Das war allerdings vor Trumps Comeback.
Manchmal ist das zwischen den Zeilen zu Lesende sehr klein gedruckt: Der Virenschutzhersteller Kaspersky unterstützt den UN Global Digital Compact, freute sich eine Aussendung des UN Tech Envoys vergangene Woche. Die Unterstützung ist nicht neu, eine Kaspersky-Aussendung bekräftigte das schon im April 2023. Schon 2022 hatte das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor dem Einsatz von Kaspersky-Software gewarnt. Und 2024 erstreckte das US Treasury Department seine Warnung vor Kaspersky auf Sanktionen gegen zwölf Führungskräfte des Unternehmens, deren Vermögenswerte eingefroren wurden. Die Unterstützung des sanktionierten russischen Unternehmens für UN Digital-Initiativen ist Anzeichen dafür, wie autoritäre Staaten UN Institutionen als Gegengewicht zu USA und EU zu nutzen versuchen - und dabei ziemlich erfolgreich sind. Hier öffnet sich unter dem Teppich ein neuer Graben.

Souveränität für alle
Es gibt verschiedenste Gründe, mehr und neue Regeln für die Digitalsphäre etablieren zu wollen. Privacy, Desinformation, Monopolbildung, Spionage, Übermacht von Tech-Konzernen im Verhältnis zur Politik, digitale Technik als hinterrücks in Hard- und Software gegossenes Recht sind nur einige davon. In Europa stehen oft Datenschutz, Desinformation und Monopolbildung im Vordergrund, in den USA rück umgekehrt die Freiheit der Digitalsphäre von staatlichem oder behördlichem Einfluss ins Zentrum. In China, dem dritten großen Player, ist wiederum eindeutig der Staat die treibende Macht, die Regeln vorgibt und hart durchgreift.
Alle drei Denkschulen der Digitalregulierung argumentieren mit dem Erhalt digitaler Souveränität: Die USA sehen sich an der Spitze und sehen jede Einschränkung kritisch. Europa will US-Einfluss zurückdrängen und EU-eigenen Digitalinitiativen Wachstumschancen ermöglichen und zumindest einen Rest europäischer digitaler Infrastruktur ermöglichen. Für China bedeutet Souveränität, sich Einmischung von außen in innere Angelegenheiten zu verbitten und sich mit eigenwilligen Interpretationen von Menschenrechten als glühender Befürworter von Menschenrechten zu präsentieren. Mit letzterer Wendung garnierte China seine Unterstützung des UN Global Digital Compact und so lässt sich auch die Unterstützung eines sanktionierten russischen Unternehmens für dieses Projekt verstehen.
China geht in seiner Digitalpolitik noch einige Schritte weiter und lobbyiert dafür, die nichtstaatlichen Organisationen ICANN und IETF zu entmachten und der UN-Organisation ITU (International Telecommunication Union) bei der zukünftigen Organisation des Internet eine relevantere offizielle Rolle beizumessen. In nichtstaatlichen Organisationen hat China wenig Relevanz; in offiziellen politischen Sphären lässt sich leichter Einfluss herstellen. China ist der größte Geldgeber der ITU.
Die Juristin Anu Bradford führt in „Digital Empires“ auf 400 Seiten aus, wie sich EU, USA und China im Wettlauf um digitale Vorherrschaft gegenüberstehen - und wie China nicht nur die eigene Innovations- und Wirtschaftsmacht nützt, sondern auch die UN-Bühne. Letzteres findet zunehmend Anklang bei kleineren autoritären Staaten in Asien und Afrika, die mögliche Gegengewichte zu westlichem Einfluss begrüßen, von antikolonialen Untertönen beflügelt werden und außerdem der Idee eines freien Internet an sich nicht so viel abgewinnen können.
Die chinesische Spielart von Digitalregulierung wir abseits der politischen Sphäre durch Technologie-Exporte unterstützt, mit denen über technische Standards auch chinesische Werte exportiert werden. Das sichert Kontrolle, Einfluss und Abhängigkeiten. So wie manche afrikanischen Staaten sich mit Straßen- oder Hafeninfrastruktur bei China dramatisch verschuldet haben, geraten andere in massive digitale Abhängigkeit und geraten damit zwischen europäische und UN-Stühle: Keine Rechenzentren oder Vermittler von Offshore-Programmierern möchten mit Staaten zusammenarbeiten, in denen China Zugriff auf Netz und Daten hat. Aktuell spürt das gerade Marokko.
Kabelkontrolle
Besonders effizient ist der chinesische digitale Imperialismus in Verbindung mit dem Infrastrukturaufbau. Die Verteidigung digitaler Infrastruktur wird auch für Europa in den nächsten Jahren zum zentralen Angelpunkt. Damit ist weniger die militärische Verteidigung vor Angriffen gemeint, sondern schlicht die wirtschaftliche Kontrolle über das physische Netz.
Bradfords „Digital Empires“ erschien 2023 und sie ist recht optimistisch für Europa. Das Bewusstsein um die Relevanz digitaler Souveränität setze sich global durch, damit gewänne die Idee der Regulierung mehr Akzeptanz, die rein markt- und freiheitsorientierte Digitalpolitik der USA gerate ins Hintertreffen. Und wenn sich als erfahrene Regulierer China und die EU gegenüberstehen, dann würden auch die USA eher die europäische Perspektive unterstützen. Das war, bevor sich ein Trump-Comeback abzeichnete und bevor Trump über Europa hinweg sogar auf Russland zuging.
Digitale Souveränität für Europa wird damit noch wichtiger. Indessen setzen aber gerade umgekehrt Tech-Unternehmen dazu an, neben Software, Servern und Consumer-Infrastruktur auch große Teile der grundlegende Infrastrukturen zu betreiben. Starlink, das am breitesten ausgebaute Satellitennetzwerk, ist im Besitz von Musk. Konkurrenz entsteht durch Amazon. In der EU gibt es immerhin Pläne für ein eigenes Satelliten-Netz, das 2028 in Betrieb gehen und es innerhalb von 10 Jahren mit Starlink aufnehmen können soll.
Daneben übernimmt Big-Tech auch ganz banale Kabelinfrastruktur. Das Verlegen von Netzen, historisch in der Verantwortung von staatlichen oder streng regulierten Telekommunikationsunternehmen, wurde in der Vergangenheit stark mit Geldern der Tech-Konzerne subventioniert. Neu ist, dass Google, Meta und Amazon jetzt auch eigene Untersee-Kabel verlegen und nicht mehr nur als Geldgeber oder Untermieter auftreten. Das hat Vorteile, wenn schneller mehr Kabel verlegt werden, die Verbindungsqualität steigt und schlecht erschlossene Gebiete vor allem im globalen Süden besser versorgt werden. Aber es birgt Risiken für die Netzneutralität, wenn kommerzielle Betreiber die Macht darüber haben, welche Information durch ihre Kabel übertragen wird, beschreiben die Journalisten Ingo Dachwitz und Sven Hilbig in ihrem neuen Buch „Digitaler Kolonialismus“. So wie Google außerhalb Europas schon Suchtreffer von Google Shopping besser rankt, als es dem eigenen Suchalgorithmus entsprechen würde (in Europa ist das Dank EU-Interventionen nicht so), oder wie Amazon eBooks zu einem quasi geschlossenen Markt gemacht hat, können Techunternehmen dann noch besser steuern, welche Inhalte und Dienste wo wie gut verfügbar sind. Das schafft neue Abhängigkeiten, in denen ganze Staaten auf der kürzeren Seite der Schaukel sitzen, und es nimmt Staaten letzte Einflussmöglichkeiten.
Das eigentlich Tragische daran: Noch vor wenigen Jahren wäre es ein Grund zum Feiern gewesen, das Internet mehr und mehr staatlicher Kontrolle entzogen zu haben. Freie Leitungen sind die wichtigste Grundlage im Kampf gegen Zensur und Netzsperren. Die Entwicklung der großen Digitalkonzerne und ihrer Führungsfiguren lässt aber Zweifel daran aufkommen, ob sie das tatsächlich in punkto Freiheitsorientierung und Demokratie so viel besser abschneiden.
Ist das das Comeback staatlicher Kontrolle? Oder muss man vielleicht einfach nur mal durchatmen und sich klarmachen, wer eigentlich die Macht hat. „Which do you expect to be around in 100 years? Facebook or France? Apple or Argentina? Microsoft or Mexico?“, fragt Harvard-Forscher Stephen Walt. Politische Macht gibt es nicht nur in China und Russland, demokratische Kontrolle ist nicht Diktatur. Das muss man libertärem Theater entgegenhalten, damit setzt sich Bradfords Einschätzung, der Regulierungsgedanke der EU wird die Oberhand gewinnen, vielleicht doch durch.
Sonst noch neu
China, Europa und die USA im Wettlauf um Digitale Souveränität.
Der digitale Regulierungsgedanke der EU könnte sich durchsetzen, meint Bradford. Das Buch erschien allerdings vor Trumps Comeback.
Flashback aus dem Bücherschrank: Tony & Me als told to Dr. Parsons - als George Bush noch der Schrecken der internationalen Politik war.